Säuerung wird rückwirkend zum 20. August zugelassen werden
Zulässig ist die Säuerung von Trauben, Most und Jungwein um max. 1,5 g/l, die von Wein um max. 2,5 g/l,jeweils berechnet als Weinsäure. Im Moststadium dient eine Säuerung ausschließlich dem Absenken des pH-Wertes zur Steigerung der mikrobiellen Sicherheit! Unerwünschtes Bakterienwachstum wird gehemmt. Die Wirksamkeit der schwefligen Säure ist bei niedrigen pH-Wert deutlich besser als bei hohem pH-Wert.
- Veröffentlicht am
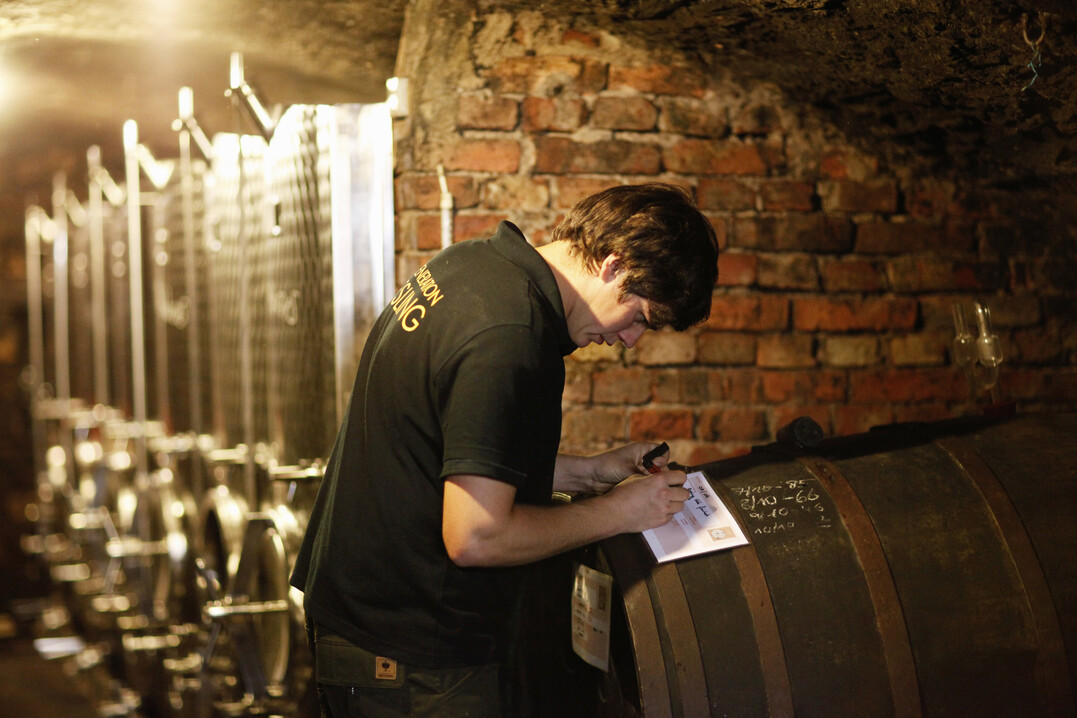
Es sollte daher eine Säuerung im Moststadium ausschließlich mit natürlicher L-Weinsäure erfolgen, da die L-Weinsäuredie die stärkste pH-Wert Absenkung bewirkt. Je früher die pH-Absenkung erfolgt, desto besser.
Eine Säuregabe kann bereits in die Saftwanne erfolgen, wenn die zu erwartende Mostmenge einschätzbar ist und der rechtliche Höchstwert nicht überschritten wird. Nicht jeder Most soll und muss gesäuert werden! Ausschlaggebend sind:
- Lesebedingungen (Temperatur, Gesundheitszustand)
- Verarbeitungsgeschwindigkeit
- pH-Wert des Mostes (bei Werten über 3,4 ist eine Säuerung sinnvoll)
Weitere Informationen zur Säuerung:
Die Säuerung und die Anreicherung, sowie die Säuerung und die Entsäuerung ein- und desselben Erzeugnisses schließen einander aus. Das heißt, da die einzelnen Stadien der Weinherstellung konkret aufgeführt sind (z.B. frische Weintrauben, Traubenmost, Jungwein), sind beispielsweise Traubenmost und Jungwein als getrennte Erzeugnisse anzusehen.
Dies hat zur Folge, dass z.B. ein Traubenmost gesäuert und der teilweise gegorene Traubenmost angereichert werden darf.
Daraus ergibt sich auch die Möglichkeit des Verschnitts zwischen einem angereicherten und einem gesäuerten Wein. Die Säuerung ist meldepflichtig und muss außerdem bei der Weinbuchführung angegeben werden. Auch wenn die Anwendung von natürlicher L-Weinsäure, L- oder DL-Äpfelsäure sowie Milchsäure zulässig sind, empfiehlt sich im Moststadium die Verwendung von L-Weinsäure (E334), da der pH-Wert dadurch am stärksten abgesenkt wird.
Es sollte ein pH-Wert <3,4 angestrebt werden. Auch wenn ein Großteil der zugesetzten L-Weinsäure als Weinstein (Kaliumhydrogentartrat) ausfällt, so bleibt doch der niedrige pH-Wert erhalten.
Nährstoffversorgung
Die Nährstoffversorgung der Trauben ist auch stark von der Wassersituation abhängig. Besonders in trockengestressten Anlagen ist die Nährstoffversorgung sehr schlecht. Eine zusätzliche Versorgung der Hefen mit Nährstoffen ist besonders bei den frühen Sorten Bacchus und Müller-Thurgau unbedingt erforderlich.
Gerade bei frühreifen Rebsorten mit hohen Erträgen ist die Nährstoffversorgung ein entscheidender Faktor, um die Reintönigkeit der Weine und den reibungslosen Verlauf der Gärung zu beeinflussen. Ein Mangel kann zur Böckserbildung, zur Gärverzögerung und zu überhöhten Restzuckergehalten führen. Der Zusatz muss erfolgen, solange sich die Hefe vermehrt, d.h. parallel zur Hefegabe oder während der ersten ein bis drei Tage nach dem Hefezusatz. Zur Hälfte der Gärung kann es bereits zu spät sein.
Hefenährsalze nicht in den Hefeansatz sondern in das Gärgebinde geben. Der Zusatz an DAP bewirkt einen kurzfristigen Anstieg des pH-Wertes. Aus diesem Grund sollte in Mosten, die einen hohen pH-Wert haben, die Zugabe von DAP erst nach dem Beginn der Gärung erfolgen. Die bei der Gärung gebildete Kohlensäure kann den pH-Wert-Anstieg schnell kompensieren. Vorsicht, bei der DAP-Gabe während der Gärung kann der Tank leicht überschäumen! In den meisten Fällen reichen 30 g/hl zur Ergänzung des natürlichen Stickstoffangebots aus. Bei starkenStresssituationen und akuter Unterversorgung kann allerdings eine DAP-Gabe von 50 g/hl (oder bis zu 100g/l) notwendig sein, um die Hefe ausreichend zu ernähren.
Der Nährstoffbedarf hängt auch stark von der ausgewählten Reinzuchthefe ab, dies sollte unbedingt beachtet werden. Der Zusatz an Thiamin ist wegen der Senkung des SO2-Bedarfs immer sinnvoll. Da die Zusatzmenge von max. 0,65 mg/l nur bei großen Mostmengen exakt abzuwiegen ist, empfiehlt sich die Verwendung eines Kombipräparats. Alternativ kann auch eine Thiamin-Dosage in Form einer wässrigen Lösung erfolgen.
Bentonitbedarf 2018
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und des heißen Sommers ist (vergleichbar zum Jahrgang 2003) mit einem überdurchschnittlich hohen Bentonitbedarf bei den 2018er Weinen zu rechnen. Nutzen Sie die Möglichkeit, durch das Mitvergären von Bentonit, besonders bei Weinen, die schnell vermarktet werden sollen, die Weine schonend eiweißstabil zu machen.


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.