Bacchus – Um zu retten, was zu retten ist
Ran an die Scheren! Die Weinlese in Bayern nimmt weiter Fahrt auf und die Zeichen stehen gut, dass sich der Jahrgang 2019 „schmecken“ lassen kann. Und auch wenn es mit dem erwarteten Ertrag von rund 80 Hektoliter pro Hektar Rebfläche auch mengenmäßig nicht schlecht aussieht, kommen einzelne Rebsorten jedoch nicht so gut weg. Auch in diesem Jahr haben die Folgen des Klimawandels deutliche Spuren hinterlassen und nicht nur den Winzern einen Sonnenbrand verpasst. Besonders die Hitzetage im Juni und Juli haben einen Großteil der Bacchus-Beeren in vielen fränkischen Weinbergen nahezu verbrannt. Muss 2020 jetzt auf den fruchtigen Schoppenwein verzichtet werden? Nein! Denn Hightech-Einsatz an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) sorgt dafür, dass gerettet wird, was gerettet werden kann.
- Veröffentlicht am

Qualität wächst im Weinberg – wohl die zentralste aller Winzerweisheiten. Doch die mit dem Klimawandel einhergehende Hitze und Trockenheit machen es zunehmend schwerer, Qualität aber auch Ertrag zu sichern.
Bald „Bacchus adé“?
Während beispielsweise der Silvaner mit den Wetterextremen und wolkenlosen Hitzetagen besser zurechtgekommen ist, hat der Bacchus, der in Franken auf rund 12 Prozent der Rebfläche angebaut wird, deutliche Spuren davongetragen. Teilweise bis zu 90 Prozent der Trauben sind je nach Lage durch die UV-Strahlung und extrem hohe Temperaturen geschädigt.
Besonders jetzt heißt es ganz genau hinschauen und es schlägt die Stunde der optischen Traubensortieranlage: Mit aufwändiger Kamera- und Infrarottechnik wird dabei Beere für Beere auf den Prüfstand gestellt, damit ausschließlich gesundes und hochreifes Lesegut für die weitere Verarbeitung zugrunde liegt. Der Technikeinsatz ist aber nicht die Lösung des Kernproblems, sondern verschafft nur Zeit. Spitzt sich der Klimawandel weiter zu, wird sich Franken wohl in den nächsten Jahren vom Bacchus verabschieden müssen.
Hitze rauf, Alkohol rauf
Doch Sonne, Hitze und Trockenheit stellen nicht nur die Reben im Weinberg vor große Herausforderungen. Auch die Oenologen im Keller kommen trotz der dort kühlen Temperaturen zum Schwitzen. Denn durch die langen und starken Sommertage wurde mehr Zucker in die Beeren eingelagert und das Volumenprozent deutlich gesteigert. Doch was tun, wenn der Weinjahrgang 2019 zwar eine Sinnesexplosion auslöst, aber den Geist nach einem Glas vernebelt? Der Alkohol muss also raus, aber wie?
Bereits im Weinberg kann mit einer rechtzeitigen Entblätterung die Reife um bis zu zwei Wochen verzögert werden. Denn weniger Blätter bedeutet weniger Fotosynthese und damit eine geringere Einlagerung von Zucker. Daneben spielt der Lesezeitpunkt eine wichtige Rolle. Wird frühzeitig geerntet, ist noch nicht so viel Zucker in den Beeren und der Alkoholgehalt bleibt moderat. Aber auch im Keller kann mittels eines Membranverfahrens der Alkohol im fertigen Wein noch reduziert werden. Alkoholreduzierte Weine schmecken insgesamt schlanker und weniger süß, da mit dem Alkohol auch der Geschmacksträger reduziert wird.
Gesetzlich ist die Reduzierung von Alkohol auf 20 Prozent des tatsächlich vorhandenen Alkoholgehaltes begrenzt.


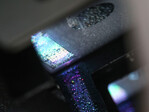

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.