
Rückenwind für die Winzer
Seit Februar 2025 steht Dietrich Rembold an der Spitze des Weinbauverbands Württemberg. Der gelernte Weinbautechniker, aktive Winzer und Vorstandsvorsitzende der Lauffener Weingärtner bringt umfassende Branchenkenntnisse und ein starkes Netzwerk in Weinwirtschaft und Politik mit. Er spricht über Wirtschaftlichkeit, faire Verbandsstrukturen und Vermarktung.
von Natalie Krampfl erschienen am 30.04.2025Welche Impulse möchten Sie im Verband setzen, um die Interessen kleiner und großer Betriebe ausgewogen zu vertreten? Im Verband ist es mir wichtig, sowohl die Interessen kleiner als auch großer Betriebe im Blick zu behalten und ausgewogen zu vertreten. Die Anforderungen sind oft sehr unterschiedlich – etwa zwischen einem Direktvermarkter und einem reinen Traubenerzeuger, der an eine Genossenschaft oder Kellerei liefert. Dennoch sehe ich es als sehr positiv, dass wir im Grundsatz alle an einem Strang ziehen und das auch in die gleiche Richtung. Mein Ziel ist es, Impulse zu setzen, die allen Betriebstypen zugutekommen. Das bedeutet: Förderungen, Strukturen und Maßnahmen müssen so ausgestaltet sein, dass sie für alle zugänglich und nutzbar sind – unabhängig von der Betriebsgröße oder der Vermarktungsform. Es darf nicht passieren, dass bestimmte Gruppen außen vor bleiben oder Maßnahmen zu einseitig wirken. Ein zentrales Anliegen ist dabei die Nutzbarkeit der verfügbaren Fördermittel – sei es aus Brüssel, Berlin oder Stuttgart. Es wäre fatal, wenn Gelder nicht abgerufen werden können, nur weil die entsprechenden Programme oder Maßnahmen fehlen. Württemberger Weine gelten oft noch als regional verankert – welche Strategien sehen Sie für Profilierung und Vermarktung über die Region hinaus? Württemberger Weine sind längst nicht mehr nur regional verankert – diese Entwicklung hat bereits vor Jahrzehnten begonnen und setzt sich kontinuierlich fort. Die zentrale Aufgabe liegt heute darin, das Profil der Weine und des Anbaugebiets weiter zu schärfen und sichtbar zu machen – sowohl nach innen als auch nach außen. Die Schutzgemeinschaft spielt dabei eine Schlüsselrolle. Sie kümmert sich um die Positionierung, die dann als Argument auch werblich genutzt werden kann und um die Frage: Was macht Württemberger Wein besonders und welches Versprechen geben wir dem Kunden? Diese Themen diskutieren wir derzeit intensiv, auch mit externer Unterstützung. Es ist uns wichtig, den Blick von außen einzubeziehen, um die Betrachtungsweise des Kunden besser einschätzen zu können. Entscheidend ist, dass wir die Gemeinsamkeiten der Region hervorheben. Denn nur so gelingt eine Ansprache, die auch beim Konsumenten ankommt – jenseits technischer Begrifflichkeiten oder innerbetrieblicher Unterschiede. Ziel ist eine klare, verständliche Botschaft, die beim Weinkunden ankommt.
Interessen kleiner als auch großer Betriebe ausgewogen zu vertreten Dietrich Rembold







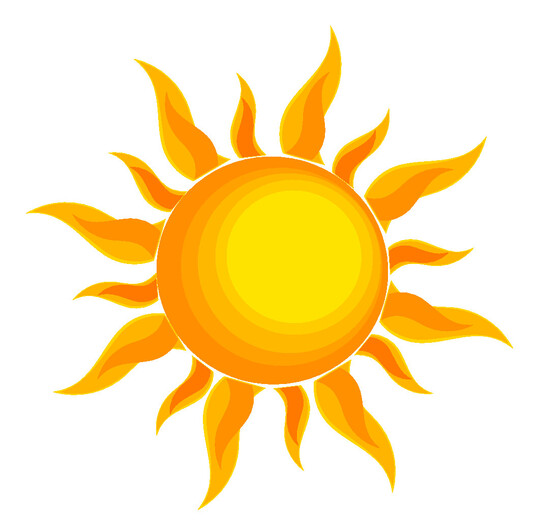

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.