
Weinbranche im Umbruch
Die Bezirksversammlung des Weinbauverbands Württemberg (WVW) bot erneut eine breite Palette an Themen, die für die regionale Weinwirtschaft von Bedeutung sind.
von Natalie Krampfl erschienen am 20.02.2025Zu Beginn präsentierte Bezirksvorsitzende Mara Walz einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Sie hob hervor, dass Frostschäden in ungewöhnlichen Lagen auftraten und erhebliche Schäden verursachten. Ein weiteres Anliegen war die zunehmende Verwilderung und das Aufkommen unbewirtschafteter Flächen. Walz sagte: „Diese Flächen werden ein zunehmendes Problem. Einmal im Jahr mulchen ist keine Bewirtschaftung.“
Strukturwandel
Im Anschluss berichtete Hermann Morast, Geschäftsführer des WVW, über die aktuelle wirtschaftliche Lage. In den letzten 28 Jahren ist die Anzahl der Weinbaubetriebe in Württemberg um 62 % gesunken, von 18.292 auf 6876 Betriebe. Dieser Rückgang betrifft hauptsächlich Betriebe mit weniger als 0,3 ha Fläche.
Trotzdem blieb die gesamte Weinbaufläche in Württemberg mit etwa 11.000 ha nahezu stabil. Bemerkenswert ist, dass 300 Betriebe rund 45 % dieser Fläche bewirtschaften. Morast wies darauf hin, dass derzeit Betriebe ihre Flächen reduzieren und prognostizierte, dass auch die Anzahl großer Betriebe in Zukunft abnehmen wird.
Ein weiteres zentrales Thema war der rückläufige Weinkonsum, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Seit 2017 ist der globale Weinverbrauch um etwa 10 % gesunken. Dieser Trend wird durch Daten der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) bestätigt, die für 2022 einen weltweiten Weinverbrauch von 232 Millionen Hektolitern angeben, was einem Rückgang von zwei Millionen Hektolitern gegenüber 2021 entspricht.
Politische Maßnahmen
Auf politischer Ebene wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Auf EU-Ebene befasst sich eine High-Level-Gruppe mit der Krise im Weinsektor und diskutiert Empfehlungen wie die Anpassung des Produktionspotenzials, die Stärkung der Resilienz gegenüber Markt- und Klimaveränderungen sowie die Ausrichtung an aktuellen Markttrends. Diese Empfehlungen befinden sich jedoch noch in der Diskussionsphase und sind nicht final beschlossen.
Auf Landesebene wurde das „Sofortprogramm Weinbau“ initiiert. Dieses umfasst unter anderem eine erhöhte Förderung von Pheromonen ab 2025 mit 200,00 Euro pro Hektar, den Einsatz für die Wiederzulassung von Kaliumphosphonat zum besseren Schutz ökologischer Betriebe vor Pilzerkrankungen sowie neue Projekte im Weintourismus.
Geschäftsmodell prüfen
Auch das Thema Rodung wurde an diesem Abend thematisiert. „Im Jahr 2025 wird es keine geförderte Rodung geben“, so Morast. Angesichts der aktuellen Situation riet er den Winzern zudem: „Prüfen Sie Ihr Geschäftsmodell Weinbau.“ Er verwies auf den Betriebscheck der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume (LEL), dessen Informationen auf der Homepage des Weinbauverbands verfügbar sind.
Darüber hinaus erinnerte er an die digitale Anmeldung für das Mittel „U?46 M Fluid“. Winzer, die dieses in Heilquellen- und Wasserschutzgebieten anwenden möchten, können sich noch bis zum 14. März 2025 dem Sammelantrag anschließen.
Abschließend informierten Kerstin Riesterer von der Heilbronner Weinbauberatung und Katharina Kohl von der Rastatter Weinbauberatung über weinbauliche Themen. Riesterer betonte die Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht der Weinberge gemäß § 26 des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG). Kohl unterstrich die Bedeutung passender Spritzintervalle im Pflanzenschutz und verdeutlichte anhand von Beispielen aus dem Vorjahr, dass Wirkstoffe nur bei korrektem Spritzzeitpunkt effektiv wirken.
Die Versammlung zeigte, vor welchen Herausforderungen der Weinbau in Württemberg steht und welche Maßnahmen ergriffen werden, um diesen zu begegnen.






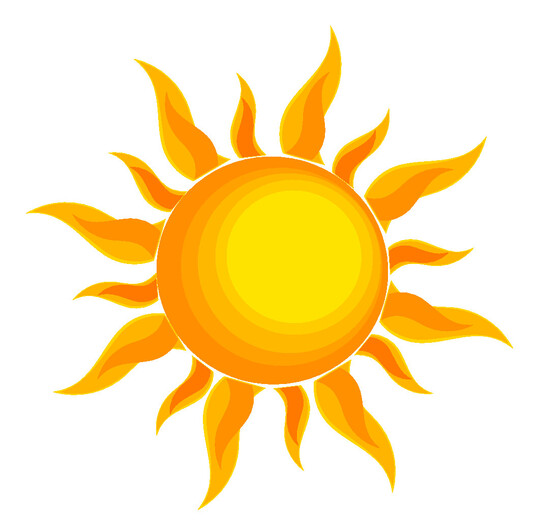

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.