Wie Schafe in Weinbergen zum Klimaschutz beitragen können
Was können Weinbauern tun, um ihre Reben besser ans Klima anzupassen? Eine nachhaltig wirkende Möglichkeit mit vielfältigen positiven Nebeneffekten ist der Humusaufbau. Um den Nutzen von Humus für einen klimawandel- und krisensichereren Betrieb sowie die konkrete Umsetzung ging es im kostenfreien Humus-Weinbau-Seminar, das der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord am 3. August auf dem Weingut von Marcus und Andrea Graf im Baden-Badener Stadtteil Varnhalt veranstaltete.
- Veröffentlicht am

Mit ihrer Art des Weinbaus produzieren die Grafs nicht nur hochwertige Weine. Sie tragen durch Humusaufbau auch zur Klimaanpassung bei und schaffen Lebensraum für eine Vielfalt von Insekten, Tieren und Pflanzen. Eines ihrer Projekte ist die ganzjährige Schafbeweidung in den Weinbergen.
„Doppelnutzungsformen sind in der Landwirtschaft ein wesentliches Instrument dafür, die Produktivität und ökologische Wertigkeit einer Fläche zu steigern“, sagt Paul Hofmann, Projektmanager des Humusprojekts beim Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und Landwirt. „Weidetiere in der Landschaft, insbesondere Wiederkäuer, tragen maßgeblich dazu bei, natürliche Nährstoffkreisläufe zu beschleunigen und das Bodenleben zu (re)aktivieren. Andererseits entstehen durch die Beweidung als schonendste Form der Bewirtschaftung erhebliche Vorteile für die Artenvielfalt.“ Naturpark-Klimaschutzmanagerin Sarina Sievert ergänzt: „Gerade in der heutigen Zeit ist das eine sehr smarte Lösung. Das gilt insbesondere auch deshalb, weil die Schafe auf ganz natürliche Weise zur Anpassung an den Klimawandel im Weinberg beitragen können.“
Mit Biss und Schiss für den Klimaschutz
Schafe halten das Gras zwischen den Reben niedrig und entblättern die Traubenzone schonend. Als „Rasenmäher“ machen sie den Einsatz von Herbiziden sowie einige Überfahrten (Mulchen, Fräsen, Unterstockpflege, Mähen) überflüssig. „Speziell für schwer befahrbare Steillagen, für Reben in Umkehrerziehung und beim Minimalschnitt sind Schafe eine ökonomisch hoch interessante Alternative zur maschinellen und menschlichen Arbeitskraft“, sagt Jakob Hörl von der Universität Hohenheim beim Humus-Weinbau-Seminar. Er koordinierte das Projekt „Schafe im Weinberg“ an der Hochschule Rottenburg und dem Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg.
Durch den Einsatz von Schafen, die Winzer entweder selbst halten oder die Beweidung als Dienstleistung vergeben, können weinbauliche Arbeitsschritte von den Schafen übernommen werden. Gleichzeitig stabilisieren sie durch ihren "Goldenen Tritt" den Oberboden, helfen bei der Anpassung an Extremwetterereignisse (Trockenheit, Starkregen) und machen so ihre Weinberge klimawandelsicherer. Wiederkäuer wie Schafe stärken durch ihren Dung auf natürliche Weise ökologische Prozesse wie etwa ein weidetypisch vitales Bodenleben, die von Menschen oder Maschinen nur schwer ausgeführt werden können.
Vielfalt im Weinberg fördern
Gleichzeitig wird die Vielfalt und Häufigkeit von Insekten, Klein- und Mikrolebewesen gefördert, die sonst in dieser Vielfalt im Weinberg nicht zu finden ist. Denn Zikaden, Heuschrecken und Schmetterlinge kommen mit dem Mulchen der Vegetation nicht zurecht, da dadurch ihr Lebensraum schlagartig verändert wird. Die Beweidung hingegen wirkt strukturerhaltend und schafft wertvolle Mikrohabitate, wie Dunghaufen und Offenbodenstellen. Schafe tragen damit maßgeblich zu einer ganzheitlichen Bewirtschaftung von Weinbergen bei und sind folglich wichtig für eine humusfördernde Landnutzung.
„Unsere Schafe sorgen dafür, dass die Natur für uns arbeitet“, beschreibt es der Affentaler-Weinbauer Marcus Graf aus Baden-Baden. Er setzt derzeit 39 Tiere der Rasse „Ouessant“ ein, bretonische Zwergschafe. „Sie sind robust, unkompliziert und klein“, sagt der Winzer. „So fressen sie nur die unteren Weinblätter ab, legen die Trauben frei, die so vor zu viel Feuchtigkeit und damit vor Fäulnis geschützt sind, und verdichten durch ihr geringes Gewicht nicht zu sehr den Boden.“
Humus schützt das Klima, indem er der Atmosphäre klimaschädliches CO2 entzieht. Durch eine Erhöhung des Humusgehalts im Boden um nur ein Prozent werden der Atmosphäre pro Hektar etwa 50 Tonnen CO2 entzogen. Humus macht die Böden zudem resistenter für die immer häufiger auftretenden Trockenphasen. Denn er speichert hervorragend Wasser und Nährstoffe. „Das macht die Böden fruchtbarer und ertragreicher. Letztlich trägt das auch zur Qualität der Trauben bei. Außerdem fördert Humus die Biodiversität“, erklärt Naturpark-Projektmanager Paul Hofmann beim Humus-Weinbau-Seminar in Baden-Baden.
So funktioniert das Naturpark-Humusprojekt
Die teilnehmenden Landwirte können auf ein umfangreiches Weiterbildungsangebot zugreifen. In den Seminaren erhalten sie das notwendige Wissen zu Bodenprozessen und Techniken zum Humusaufbau. Zum Angebot gehören mehrtägige Basiskurse, themenspezifische Aufbaumodule, Feldtage auf beispielhaften Höfen und regelmäßige Humus-Treffen zum Praxis-Austausch.
Die Inhalte gestalten die Projektmanager des Naturparks, Paul Hofmann und Sarina Sievert, gemeinsam mit renommierten Experten aus dem Bereich der regenerativen Landwirtschaft. „Sich auszutauschen und über die unterschiedlichen Möglichkeiten informiert zu sein ist sehr wichtig, weil die Maßnahmen individuell auf den Betrieb abgestimmt sein müssen“, erklärt Hofmann. Bei der Durchführung des Projekts kooperiert der Naturpark mit dem gemeinwohl-orientierten Unternehmen positerra.
Eine finanzielle Unterstützung für die Landwirte und Winzer bei der Umstellung auf eine regenerative Landwirtschaft ermöglichen regionale Partnerschaften. Emittenten wie Unternehmen und Institutionen gleichen über Humusprämien regional einen Teil ihrer Emissionen aus und helfen so Landwirten dabei, Humus aufzubauen. Es handelt sich um einen freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz, nicht um den Erwerb von Zertifikaten zur Kompensation.
Teilnehmende Emittenten können über den Naturpark direkt nachvollziehen, in welchen Partnerbetrieben ihre Emissionen ausgeglichen werden. „Das stärkt das Bewusstsein für die Arbeit der Landwirte und schafft vielfältige Möglichkeiten für eine vertiefte, partnerschaftliche Zusammenarbeit“, sagt Hofmann vom Naturpark.











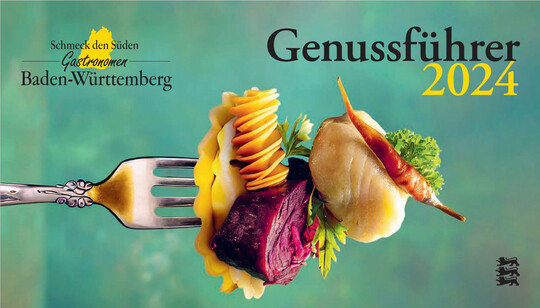

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.