
Kupfereinsatz birgt Risiken
Der Einsatz von Schafen im Weinbau kann aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes positiv bewertet werden. Allerdings sind viele der eingesetzten Pflanzenschutzmittel für die Tiere risikobehaftet.
von Dr. Nicolas Schoof, PD Dr. Esther Humann-Ziehank erschienen am 23.08.2024Pflanzenschutzmittel können ein Risko für Schafe im Weinberg sein. Das gilt auch für das heute vor allem im Bio-Weinbau eingesetzte Kupfer, zu dem es bezüglich dieser Thematik bereits Erkenntnisse gibt. Im Gegensatz zu anderen Weidetieren sind Schafe ausgesprochen kupfersensibel und Überschreitungen des vorhandenen, aber sehr geringen Kupferbedarfs können problematisch werden. Sollen Schafe im Weinberg eingesetzt werden, sollte immer ein Tierarzt einbezogen werden.
Akute Kupfervergiftungen, die bei einer einmaligen Aufnahme einer sehr hohen Kupfermenge auftreten können, sind selten. Häufiger ist der Fall, dass Kupfer durch eine anhaltende Aufnahme bedarfsüberschreitenden Futters in der Schafleber angereichert wird. Ist die Aufnahmekapazität der Leber erschöpft, kommt es zu Zellschädigungen und zur schlagartigen Freisetzung großer Kupfermengen in den Organismus.
Kupfervergiftungen
Dieser Prozess, der hämolytische Krise genannt wird, führt dann zur Beschädigung roter Blutkörperchen und ist fast immer tödlich. Die plötzliche Freisetzung wird häufig durch Stresssituationen ausgelöst. Hetzen durch Hunde, Geburt, Schur oder Transport sind beispielsweise auslösende Ursachen.
Bis es zur Kupferfreisetzung aus der Leber kommt, sind die Tiere nicht beeinträchtigt und zeigen keine offensichtliche Veränderung des Gesundheitszustandes, was beim Tierhalter zu der Fehlannahme führen kann, dass keine kritische Belastung vorliegt. Eine Kupfervergiftung ist dem Tier erst anzusehen, wenn Kupfer bereits aus der Leber freigesetzt wurde.
Dann zeigen unter anderem die Schleimhäute der Augen durch die Abbauprodukte der roten Blutkörperchen eine dunkel-gelbliche Verfärbung. Auch der Urin ist häufig ausgesprochen dunkel gefärbt. Heilungschancen bestehen in dieser Phase nicht.
Eine Kupfervergiftung ist dem Tier erst anzusehen, wenn Kupfer bereits aus der Leber freigesetzt wurde Dr. Nicolas Schoof
Eine gezielte Senkung der Leberkupferwerte ist auch vor einer hämolytischen Krise, wenn überhaupt, für Schafe nur sehr begrenzt möglich und auf natürlichem Weg ist die Wiederausscheidungsrate aus der Leber sehr gering. Um chronische Kupfervergiftungen zu verhindern, muss eine gesundheitsschädliche Kupferzufuhr und -anreicherung also vorab, sprich prophylaktisch, vermieden werden.
Kupferhaltige Pflanzenschutzmittel
Bei der Beweidung von Weinbergen ist die Kupfersensibilität von Schafen relevant. Kupferhaltige Pflanzenschutzmittel werden im Weinbau seit etwa 150 Jahren gegen verschiedene Rebkrankheiten eingesetzt. Bei einer Spritzung gelangt das Pflanzenschutzmittel auf die Rebblätter und über Abwaschung sowie die Abdrift der Spritzung auch auf die Begleitvegetation in den Rebgassen.
Kupferhaltige Pflanzenschutzmittel haften nach der Ausbringung zunächst an der Vegetation und werden erst bei einem starken Niederschlagsereignis (> 20 mm) in relevanten Mengen in Richtung Boden abgewaschen. Die Kupferkonzentrationen der Vegetation bleiben daher oft über viele Wochen nach einer Behandlung hoch.
In einer Schweizer Fallstudie wurden im Jahr 2019 im August 42 bis 225 mg Kupfer pro kg getrockneter Vegetation (Trockensubstanz = TS) gefunden – obwohl nach der Spritzung und vor der Probenahme bereits zwei Starkniederschlagsereignisse registriert wurden. Die Kupferwerte der Vegetation nach einer Spritzung hängen sicherlich stark von der Ausbringungstechnik und Aufwandmenge ab, sodass die Übertragbarkeit der zuvor genannten Werte auf andere Flächen unklar ist.
Eine relevante „Verdünnung“ der Kupferwerte nach einer Spritzung bewirkt vor allem das Pflanzenwachstum. Das benötigt aber ebenfalls relativ viel Zeit. In der Beispielstudie aus der Schweiz nahm der Kupfergehalt der Begleitvegetation um 30 bis 50 % innerhalb von etwa vier Monaten nach der letzten Pflanzenschutzbehandlung ab.
Kupfer bleibt langfristig im System
Bei dauerhaft mit Begleitvegetation begrünten Rebgassen gelangt zunächst nur relativ wenig Kupfer auf den Boden. Dorthin kommt es erst durch die Abwaschung von der Vegetation und das Mulchen. Ist Kupfer einmal im Boden angekommen, überdauert es dort etliche Jahrzehnte, denn eine Auswaschung aus dem Boden spielt zumindest auf dauerhaft begrünten Flächen keine relevante Rolle. Auch ein nutzungsbedingter Biomasseentzug existiert im Weinbau kaum, da die Begleitvegetation in der Regel nicht entfernt wird.
Da Kupfer dem Boden kaum entzogen wird, reichert es sich in den Böden der Weinberge leicht an, wenn kupferhaltige Spritzmittel eingesetzt werden. Heute sind die maximalen Kupfergaben im mehrjährigen Mittel auf 3 kg Kupfer pro Hektar und Jahr begrenzt. Bis in die 1940er-Jahre wurden drastische Kupfergaben von über 50 kg/ha jährlich eingesetzt. Deshalb weisen vor allem Böden, auf denen schon sehr lange Weinbau betrieben wird, oft hohe Kupfergehalte auf.
In welchem Umfang Kupfer aus dem Boden wieder in die Vegetation gelangt, wird entscheidend vom pH-Wert, dem Anteil organischer Substanz und der Sorptionsfähigkeit des Bodens mitbestimmt. Kalkreiche Böden und ein hoher organischer Substanzanteil hemmen die Kupferaufnahme der Vegetation.
Die Kupferaufnahme der Pflanzen aus dem Boden ist generell eher begrenzt und Bodenkupferwerte zur Risikoabschätzung deshalb auch nicht aussagekräftig. Es können aber aufgrund der standörtlichen Voraussetzungen und der historischen Belastung in der Vegetation selbst dann Kupferwerte oberhalb der Grenzwerte auftreten, wenn in den vergangenen Jahren überhaupt kein Kupfer mehr ausgebracht wurde.
Stark erhöhte Kupferkonzentrationen treten in der Vegetation des Weinberges in erster Linie nach einer aktuellen kupferhaltigen Spritzung auf. Die Menge der jährlichen Kupfergaben im öko-zertifizierten Weinbau ist – aus Sicht der Schafgesundheit bei Nutzung der Rebgassen als Weide – oft zu hoch.
Anders als im konventionellen Anbau sind im Öko-Anbau nur wenige Pflanzenschutzmittel gegen Pilzkrankheiten zugelassen und kupferhaltige Präparate sind davon mit Abstand die wirksamsten. Auch im konventionellen, integrierten Weinbau wird Kupfer eingesetzt, allerdings ist dies aus Sicht des Pflanzenschutzes hier nicht erforderlich.
Wo liegen die Grenzwerte?
Im Weinberg kann Kupfer (Cu) über die Aufnahme von Blättern der Reben, der begleitenden Vegetation und womöglich auch durch die Aufnahme von Bodenmaterial in das Tier gelangen. Die Gesamtfutterration sollte für Schafe mit Blick auf den Kupferbedarf 6 bis 10 mg Cu/kg TS aufweisen. Futtermittelrechtliche Höchstgehalte betragen derzeit für Schafe generell 15 mg Cu/kg im Alleinfutter (bei 88 % TS) bzw. der Futterration.
Die Kupferverträglichkeit eines Schafes ist in Grenzen rassespezifisch. Texel-Schafe und Ostfriesische Milchschafe gelten beispielsweise als besonders kupfersensibel. Für empfindliche Rassen gelten daher bereits 8 bis 10 mg Cu/kg TS im Futter als tolerable Höchstgrenze. Einen Handlungsrahmen bildet zudem grundsätzlich das Tierschutzgesetz, das die Pflicht des Tierhalters unterstreicht, ein Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren.
Das Risiko abschätzen
Um das Risiko im Einzelfall besser einschätzen zu können, sind zwei Testverfahren relevant und der Praxis zu empfehlen:
- Zunächst muss der Kupfergehalt der Vegetation untersucht werden. Dies ist in verschiedenen Laboren möglich, die Futtermittelanalysen anbieten. Dazu wird die Vegetation, die von den Schafen potenziell gefressen wird, an mehreren repräsentativen Orten kontaminationsfrei gewonnen und als Mischprobe eingesendet. Idealerweise wird das einmal im Winter und – wenn auch im Sommer beweidet wird – einmal im Sommer durchgeführt, um mögliche witterungsbedingte Unterschiede erfassen zu können. Wird das Laub der Reben gefressen, muss auch das getrennt berücksichtigt werden. Das tritt in der Vegetationszeit immer auf, wenn die Blätter vom Äser erreicht werden können. Die Analyse der Vegetation ist vor allem eine recht zuverlässige Möglichkeit einer Vorab-Risikoabschätzung von derzeit ganzjährig nicht mit Kupfer behandelten Flächen. Wird aktuell Kupfer ausgebracht, müsste die Vegetation nach jeder Spritzung jeweils vor dem Start der Beweidung erneut geprüft werden. Werden die weiter oben angegebenen Grenzwerte überschritten, kann die Fläche nicht beweidet werden.
- Die Überprüfung der Kupferkonzentration von Leberproben geschlachteter Tiere ermöglicht eine exakte Darstellung der tatsächlichen Belastungssituation eines Schafes und, sofern die untersuchten Schafe die Fütterungsbedingungen der Herde repräsentieren, auch der Herde. Aufgrund tierindividueller Unterschiede sollten immer mehrere Proben eingesendet werden, um zuverlässig auf den Kupferstatus der Herde schließen zu können. Die Untersuchungen bieten veterinärmedizinische Labore an. Mit diesem Verfahren sollte bestenfalls vor der Beweidung von Weinbergen begonnen worden sein, um Daten zur Ausgangssituation zu gewinnen. Wegen des möglichen Anreicherungseffektes sollte dieses Monitoring so lange fortgeführt werden, wie die Schafe eventuell belastete Flächen beweiden, was nur bei regelmäßig anfallenden Schlachttieren durchführbar ist. Als Probe reicht ein etwa walnussgroßes Leberstück. Die Probe kann zunächst eingefroren werden, wenn sie mit anderen Proben zu einem späteren Zeitpunkt verschickt werden soll. Wird durch die gemessenen Leberkupferkonzentrationen eine Überversorgung festgestellt, sollten die Tiere unverzüglich und dauerhaft auf andere Weiden gebracht werden, sofern nicht andere mögliche Eintragsquellen (zum Beispiel nicht für Schafe ausgewiesenes Mineral- oder Kraftfutter) eindeutig ursächlich sind.
Die Anwendung dieser Verfahren ist im Sinne der Tiergesundheit sehr wichtig, kostengünstig und erfordert nur einen geringen zeitlichen Aufwand. In der bereits erwähnten Schweizer Studie wurde eine Winterbeweidung von zertifizierten Fallbeispielreben einer relativ jungen Rebanlage als „einigermaßen sicher“ befunden.
Es sollte vor einer Beweidung unbedingt immer ein enger, regelmäßiger und offener Austausch mit einem Tierarzt gesucht werden PD Dr. Esther Humann-Ziehank
Es besteht das Problem, dass die Kupfergehalte auf aktuell noch kupferbehandelten Flächen in der Vegetation nicht nur standörtlich, sondern aufgrund witterungs- und wachstumsbedingter Unterschiede zum Start einer möglichen Beweidung jährlich variieren dürften. Auf in der Vegetationsperiode mit Kupfer behandelten Reben kommt nach Vegetationsuntersuchung wohl nur eine Winterbeweidung infrage.
Einordnung und Ausblick
Natürlich sind auch andere Spritzmittel des Weinbaus für Schafe risikobehaftet. Die Beweidung von Weinbergen kann zwar für den Umwelt- und Naturschutz viele positive Effekte erzeugen: Sie steigert die Flächeneffizienz, weil der eigentlich wertvolle Aufwuchs der Begleitvegetation nicht mehr nur gemulcht wird. Schafe können auch weinbaulich gewünschte Ökosystemleistungen ankurbeln. Ein verbessertes Bodenleben sei als ein Beispiel genannt. Auch die Biodiversität kann profitieren.
Unabhängig von den vielen möglichen positiven Effekten haben die Tiergesundheit und die rechtlichen Rahmenbedingungen aber Priorität. Das kann und wird in vielen Fällen dazu führen, dass eine Beweidung unter den gegebenen örtlichen Voraussetzungen nicht möglich ist. Es sollte deshalb vor einem möglichen Beginn und aber auch während der Umsetzung unbedingt immer ein enger, regelmäßiger und offener Austausch mit einem Tierarzt gesucht werden.






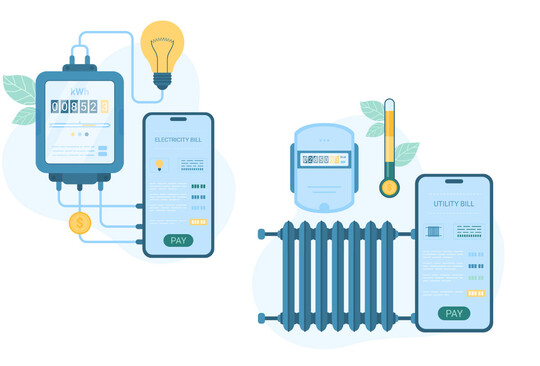






Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.